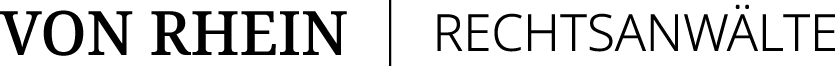Gerade in der kalten Jahreszeit kommt es vor, daß Schimmel in Mietwohnungen auftritt. Streit über die Ursache ist häufig die Folge und damit die Frage, wer für den Schaden verantwortlich ist. Vermieter sehen die Ursache oft darin, daß der Mieter nicht oft genug lüftet oder zu wenig heizt. Mieter schieben die Schuld hingegen auf bauseitige Mängel.
1. Mängelanzeige durch den Mieter
Der Mieter ist, wenn er Schimmelbefall feststellt, nach § 536 c Abs. 1 S. 1 BGB zunächst einmal nur verpflichtet, dem Vermieter das Problem zu melden.
2. Beweislast des Vermieters
Es ist dann Sache des Vermieters zu beweisen, daß
- die Wohnung gemessen am Standard des Baujahres keine wärmetechnischen Baumängel aufweist und
- keine Schäden vorliegen, die Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen lassen.
Dies kann oft nur ein Sachverständiger feststellen. Allein die Tatsache, daß der Vermieter der Ursache des Schimmels nachgeht oder diesen erst einmal beseitigen läßt, stellt gemäß Urteil des BGH vom 23.9.2020 — XII ZR 86/18 kein Anerkenntnis dafür dar, daß ein von ihm zu verantwortender bauseitiger Mangel vorliegt.
Ein starkes Indiz dafür, daß keine bauseitigen Probleme vorliegen, ist regelmäßig, daß die Wohnung noch nie von Schimmel befallen war. Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 19.3.2014 — 307 S 151/13 entschieden, daß die Ursache für Schimmel beim Mieter zu suchen ist, wenn der Vermieter nachgewiesen hat, daß sowohl die Außenwand des Gebäudes als auch die Fensterelemente keine Feuchtigkeit eindringen lassen.
Bei älteren Wohnungen, die in punkto Wärmedämmung zwar dem Stand des Baujahres, aber nicht heutigen Maßstäben entsprechen, kann verstärktes Heizen und Lüften angebracht sein. Zumutbar ist es bei einer ca. 30 m² großen Wohnung bei Anwesenheit von zwei Personen während des Tages täglich insgesamt vier Mal durch Kippen der Fenster für etwa drei bis acht Minuten zu lüften (s. Urteil des BGH vom 18.4.2007 — VIII ZR 182/06)
3. Beweislast des Mieters
Wenn dem Vermieter sich entlasten kann, muß der Mieter den Nachweis antreten, daß er die Wohnung ausreichend beheizt und gelüftet hat und die Ursache für den Schimmel jedenfalls nicht bei ihm liegen kann.
- Die Temperatur in Wohnräumen sollte bei mindestens 20 °C liegen, in Schlafräumen darf es mit bis zu 16 °C etwas kühler sein.
- Im Regelfall reicht es aus, eine Wohnung morgens und abends einmal quer zu lüften. Das Ankippen der Fenster reicht nicht aus. Je nachdem, wie viele Personen sich tagsüber in der Wohnung aufhalten, kann das auch öfter erforderlich sein. Ist eine Wohnung tagsüber unbewohnt, entsteht auch keine Feuchtigkeit durch Kochen oder Badezimmernutzung.
Im Einzelfall ist ein Hygrometer mit Datenlogger hilfreich. Mit so einem Meßgerät lassen sich Feuchtigkeits- und Temperaturwerte über längere Zeiträume aufzeichnen und speichern. Vermieter können von ihren Mietern verlangen, den Einbau solcher Geräte zu dulden, um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden festzustellen (Beschluß des Landgerichts Augsburg vom 17.12.2004 — 7 S 3173/04).
4. Ansprüche der Parteien
Ist der Schimmel vom Mieter verursacht worden, hat der Vermieter Anspruch darauf, daß dieser den Schaden beseitigt und sein Wohnverhalten derart ändert, daß kein neuer Schimmel auftritt. Der Mieter muß auf ausreichende Belüftung und Beheizung achten.
Ist der Schimmel aber bauseitig bedingt, muß der Vermieter mit folgenden Ansprüchen rechnen:
- Der Mieter kann gem. § 536 Abs. 1 BGB Mietminderung für die Zeit des Schimmelbefalls geltend machen. Je nach Umfang des Schimmelbefalls wurden gerichtlich schon bis zu 80 % Mietminderung zugesprochen.
- Wenn er durch die Schimmelbelastung erkrankt und dies nachweisen kann, kann er auch dafür gem. § 536 a Abs. 1 BGB Ansprüche anmelden.
- Der Mieter darf auch gem. § 543 Abs. 1 BGB kündigen, wenn von dem Schimmel eine Gesundheitsgefahr ausgeht und der Vermieter sich geweigert hat, die Wohnung zu renovieren. Dies stellt einen wichtigen Grund für eine außerordentliche fristlose Kündigung dar.